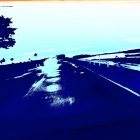Der 17. Januar 1993 war ein Sonntag. Es war der Tag, an dem Marcus und sein Vater sich in die Haare gerieten. Marcus war 17. Da müssen ab und an Grenzen ausgelotet werden. Marcus‘ Vater: 41. Polizist. Mitglied der Motorradstaffel seiner Behörde.
Keine guten Nachrichten
„Am Montagmorgen hatte ich in den ersten beiden Stunden frei“, erinnert sich Marcus. Die beiden (jüngeren) Brüder: in der Schule. Die Mutter: bei der Arbeit. Als es an der Haustüre schellte und zwei Kollegen von Marcus‘ Vater vor der Tür standen, hatte der Junge kein gutes Gefühl. „Wo ist deine Mutter?“ „Auf Arbeit.“ „Dann müssen wir jetzt dahin fahren.“
Marcus hat einen Film abgespeichert: ein langer Gang – die Mutter kommt den Beamten entgegen – sie blickt in fragende Gesichter. „Wir haben keine gute Nachricht für Sie. Ihr Mann hatte einen Unfall.“ Als Marcus` Mutter Genaues wissen möchte, schütteln die beiden den Kopf. Szenen wie diese brennen sich ins Gedächtnis. „Ich musste dann noch einen meiner Brüder aus der Schule abholen“, erinnert sich Marcus.
Das Bild im Kopf
Am Dienstag: ein Bild in der Zeitung. Auf dem Bild: ein zerfetztes Motorrad. Wenn schon das Krad so aussieht … Marcus wünscht sich einen verantwortungsvolleren Umgang der Medien mit eben solchen Bildern. „Ich denke, dass mancher sich nicht vorstellen kann, was ein veröffentlichtes Bild bei den Angehörigen auslöst.“
Der Unfall konnte nie eindeutig rekonstruiert werden. Außer Marcus‘ Vater war ein Lastwagen beteiligt. Der Vater: ein guter – ein sicherer Kradfahrer. „Ein Kollege hat meiner Mutter gesagt, dass es sich ja vielleicht auch um einen Suizid gehandelt haben könnte.“ Ein unfassbarer Gedanke. Den Toten – so der Ratschlag der Polizisten an die Familie – den Toten solle man sich besser nicht mehr ansehen.
Beim Abschied wuchs mir ein Kloß im Hals. Wenn du fort bist – weit genug – werde ich den Kloß verschlucken, aber das Bild wird bleiben.
Kein Platz für Schmerzen
Jahre später: Marcus wird Polizist – wie sein Vater. Die Erlebnisse im Januar 1993: eingemauert in der Seele – Marcus‘ Seele. Kein Platz für Schmerzen. Kein Platz für Fragen. Marcus lernt zu leben. Er lebt mit den Bildern. Er lebt mit einer diffusen Schuld: Da ist dieser letzte Streit mit seinem Vater – ein Streit, der ohne Versöhnung endete. „Ich weiß nicht einmal mehr, worum es damals ging.“ Eine Nichtigkeit wahrscheinlich. In der Rückschau wird der Streit zu einer untilgbaren Schuld. Dazu die Bilder im Kopf. Nichts ist so grausam wie die Phantasie. „Ich weiß noch, dass ich vor dem geschlossenen Sarg stand und mich gefragt habe, ob mein Vater wirklich da drin ist.“
Weggesperrt
Ein Trauma entsteht: die Schuld. Die offenen Fragen. Das Bild im Kopf. Was damals passierte, als die Beamten die Todesnachricht überbrachten, würde man in ein Lehrbuch schreiben: So nicht! Für Marcus entstanden mit der Wunde in der Seele Wut und Ohnmacht – alles irgendwie weggesperrt im Seelendampfkessel.
Marcus gründet eine Familie.Wieder gehen Jahre ins Land. Marcus arbeitet im Landeskriminalamt – ist Sachverständiger für Fingerspuren. Die Behörde daheim: für ihn nie eine Einsatzalternative. „Da wollte ich auf keinen Fall hin.“ Manchmal wachsen Gräben, ohne dass jemand eine Schaufel benutzt.
Der innere Schmerz
Die Wunde reißt auf, als Marcus und seine Frau das erste Kind bekommen. Der Tod des Vaters liegt zwölf Jahre zurück. „Als unsere Tochter zur Welt kam, war mir klar, dass ich jetzt etwas tun muss.“ Der quälende Gedanke in Marcus‘ Kopf: Was, wenn ihm oder seiner Frau etwas passiert? Die Frage trifft auf einen inneren Schmerz – es ist der Schmerz über die Unmöglichkeit, einen Kreis zu schließen. Der Kreis: Dem Vater das eigene Kind nicht in die Arme legen zu können. „Ich habe dann begriffen, dass ich etwas tun muss mit diesem Trauma.“ Marcus begibt sich in Therapie. Ein erster Schritt auf dem Weg zu einer späten Heilung.
„Mein bester Freund von damals ist auch heute noch mein bester Freund. Er arbeitet für den Weißen Ring. Das ist doch kein Zufall.“ Der Freund bringt Marcus – es ist das Jahr 2016 – mit dem damaligen Opferschützer Johannes Meurs zusammen. „Der Johannes war damals an der Unfallstelle und ist 23 Jahre später mit mir dorthin gefahren.“
23 Jahre später
Meurs hilft Marcus beim Löschen der Bilder im Kopf. „Dein Vater war ein versierter Fahrer“, erklärt er und sagt, dass viel dafür spricht, dass der Vater im Moment des Unfalls versucht habe, vom Motorrad „abzusteigen“. Der Sprung in die Rettung wird zum Sprung in den Tod. Zum ersten Mal hört Marcus, dass man seinen Vater äußerlich unbeschadet gefunden hat. Ein Knoten beginnt sich aufzulösen. Das Verzeihen kann beginnen. Marcus kann sich selbst verzeihen, aber er kann auch seinen Frieden machen mit allem, was – sagt man es vorsichtig – nicht gut gelaufen ist.
Seit 2018 arbeitet Marcus in eben der Behörde, in die er Jahre zuvor niemals hatte wechseln wollen. Er arbeitet jetzt im Opferschutz – gehört zu denjenigen, die Todesnachrichten und solche von schweren Unfällen überbringen. Sein Credo: „Wir müssen, wann immer es möglich ist, den Menschen ermöglichen, Abschied zu nehmen.“
Thema Abschied
Marcus weiß, was die Bilder im Kopf anrichten: Sie werden zu Tatoos in der Seele werden und liegen zentnerschwer auf dem Leben. Da ist einer, der weiß, wie es sich anfühlt, mit einem Schmerz zu leben. Und nicht nur er weiß das. „Meine Frau hat das all die Jahre miterlebt – wir kannten uns damals schon.“
Geschichten wie die von Marcus betreffen fast immer viel mehr Menschen. Sie greifen ein in das soziale Umfeld – sie können Familien verändern. Marcus‘ Thema: Der Abschied. „Niemand von uns kann den Menschen ihre Trauer nehmen, aber es ist wichtig, dass keine falschen Bilder entstehen.“ Natürlich kennt Marcus die Bedenken, die Verwandte haben, sich einen Verstorbenen anzusehen, der bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. „Ich beschreibe dann, wie es mir gegangen ist. Die letzte Entscheidung kann ich – können wir – den Hinterbliebenen nicht abnehmen.“ Marcus hat seinen Frieden gefunden. Vielleicht ist ‚gefunden‘ das falsche Wort – es klingt irgendwie zufällig.
Rückmkeldung ist wichtig
Aus den Bildern des Schreckens ist ein Bild des Zur-Ruhe-Kommen-Könnens geworden. Marcus hat seine Erfüllung gefunden: Er ist Mitglied im Opferschutz-Team und ist angekommen in und bei der Polizei. In der Situation. Bei den Kollegen. In dem Gefühl, das Richtige zu tun. „Das Verrückte ist ja, dass manchmal niemand etwas falsch machen möchte und trotzdem nicht das Richtige passiert. Ich bin sicher, dass die Kollegen damals nichts Falsches tun wollten. Rückmeldung ist wichtig: für uns alle – egal, was einer macht. Für mich ist es wichtig, den Menschen in einer solchen Situation das Gefühl zu geben: Sie können mich alles fragen – ich werde versuchen, Antworten zu finden. Ganz oben steht: Ich bin für Sie da.“ Mit Marcus, denkt man, schließt sich ein Kreis, der jetzt endlich kein Teufelskreis mehr ist. In der Therapie hat er einen Brief an seinen Vater geschrieben. „Den habe ich dann zu seinem Grab gebracht und hinter seinem Grabstein verbrannt.“ Endlich ist alles gesagt.
Info zum Opferschutz der Kreispolizeibehörde Kleve
Seit über 20 Jahren steht das Bereitschaftsteam der Kreispolizeibehörde Kleve 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr bereit, um jederzeit die Benachrichtigung und Betreuung Angehöriger bei Einsatzlagen mit Tod oder lebensbedrohlicher Verletzung gewährleisten zu können. Im letzten Jahr waren die Opferschützer bei 93 Einsätzen (unter anderem 41 Verkehrsunfälle). Derzeit besteht das Team aus rund 35 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Tätigkeit im Nebenamt übernehmen. Seit 2020 ist Joachim Verhoeven Opferschutzbeauftragter der KPB Kleve Telefon: 02823 108-1977 .