Vor dem Museum Kurhaus Kleve steht ein Wagen mit Leipziger Kennzeichen. Besuch aus dem Osten? Nein. Der Wagen gehört dem Chef. Der studierte in der Bach-Stadt, als dort deutsche Geschichte geschrieben wurde. Ein Gespräch …
NN: 35 Jahre gesamtdeutscher Feiertag. Habe ich richtig gerechnet?
KUNDE: Man muss ja mit dem Rechnen aufpassen. 9. November ’89: Mauerfall. Also 36 Jahre. Aber der Tag der deutschen Einheit wurde ja erst am 3. Oktober ’90 erstmals begangen. Also 35 Jahre.
NN: Okay. Kommen wir zu Geschichte. Und das im doppelten Sinn, denn Geschichte im Sinne von Historie – also Zeitgeschichte – ist ja die Summe von Geschichten: also Erlebnissen.
Ein Staat in Agonie
KUNDE: Ich habe damals in Leipzig gelebt und war sogenannter Forschungsstudent – das war die Höchstform des Studentenseins, die man haben konnte. Das eigentliche Studium war beendet. Es folgte ein Zusatzstudium über drei Jahre an dem Lehrstuhl für Theorie und Geschichte der Bildenden Kunst. Man hatte die Gelegenheit, vieles von dem, was im Studium quasi im Schnelldurchlauf verhandelt worden war, zu vertiefen. Das war für mich eine glückliche Zeit, aber es war eben auch die Zeit, in der die Agonie – also die Endphase der DDR – in vollem Gange war.
NN: War das damals bereits klar?
KUNDE: Natürlich hätte niemand eine exakte Vorhersage machen können, aber da war eben dieses starke Gefühl der Auflösung und des Zerfalls, was sich nicht zuletzt auch anhand der Architektur vermittelt hat. Alles war ziemlich verfallen. Heruntergekommen. Dadurch entstanden aber viele Nischen, in denen Dinge passieren, die vorher nicht möglich gewesen waren. Plötzlich gab es Galerien, die vorher außerhalb des staatlichen Kunsthandels undenkbar gewesen wären. Die berühmteste war die Galerie „eigenart“. Gerd Harry Lybke, genannt Judy, war der Inhaber und er begann zunächst ’83 mit Ausstellungen in seiner Wohnung. Damals habe ich in Leipzig mein Studium begonnen. Ich bin dann relativ schnell in diese Kreise geraten. Das fand ich natürlich toll, aber das war irgendwie eine Art Gegenwelt dessen, was ich bis dahin erlebt hatte. Ich war 21 und ein wohlerzogener junger Mann – irgendwie vollkommen ahnungslos. Und mit einem Mal traf ich also auf Aussteiger und schillernde Existenzen. Das war für mich völlig neu und ich fragte mich, wie es sein konnte, dass ich von alledem vorher kaum etwas mitbekommen hatte. Wie war es möglich, dass diese Leute in der komischen DDR existieren konnten? Es gab ein paar neuralgische Punkte, an denen man diese Leute traf. Das war natürlich nicht nur in Leipzig der Fall, sondern beispielsweise auch in Chemnitz – damals noch Karl-Marx-Stadt. Diese 80-er Jahre waren einerseits eine tolle Zeit, weil Freiräume wuchsen – andererseits spürte man eine Art Grundstimmung: Das kann nicht mehr lange gut gehen. Entweder würde das Ganze auf schrecklichste Art implodieren oder eben friedlich. ’89 war ja auch das Jahr des Massakers auf dem Tiananmen-Platz. Das schürte schlimmste Befürchtungen.
NN: Kannst du dich an das genaue Datum erinnern?
KUNDE: Es war, denke ich, im Juni.
[Es war der 4. Juni 1989. Anm. d. Red.]
Hintergrundrauschen
KUNDE: Das war also das mediale Hintergrundrauschen, das man empfand. Das wirkte sich in der DDR deutlich aus. Die Zahl der Menschen, die über Ungarn und die tschechische Botschaft in den Westen gingen, stieg ständig an. Ein deutliches Signal: Das würde nicht mehr lange so gehen.
NN: Wie war deine Situation damals?
KUNDE: Für mich begann das Ganze damals in Prag.
NN: Wir sind im Jahr ’89?
Wenzelsplatz
KUNDE: Richtig. Ich saß mit meiner Freundin in einem Hostinec [Hostinec = Gasthof; Anm. d. Red.], wo man tschechisches Bier trank. Da kam dann ein Typ auf uns zu und legte einen Zettel auf den Tisch. Auf dem Zettel stand ein Datum: 21. 8. 1968. Der schaute uns fragend an. Der wollte wissen, ob wir etwas anfangen konnten mit diesem Datum. Klar. Das wussten wir. Das war der Einmarsch der Russen und somit das Ende des sogenannten Prager Frühlings. Der Typ sagte dann nur „Wenzelsplatz“ und zeigte auf den Zettel. Ich glaube, es war der 19. August 1989. Wir sind dann natürlich hin zum Wenzelsplatz. Das war ein berührendes Erlebnis. Rund um den Platz standen viele Menschen – es wurden immer mehr. Die riefen Swoboda und Dubcek. Swoboda heißt Freiheit und Dubcek war die Symbolfigur des Prager Frühlings. Dann fuhren Militärfahrzeuge mit großen Megafonen auf und haben in Tschechisch dazu aufgerufen, diesen Platz zu verlassen.
NN: Eine letzte Warnung?
KUNDE: Ja. So würde ich das sehen.
NN: Und dann?
KUNDE: Nun ja, wir waren jung und irgendwie abenteuerlustig und haben beschlossen: Wir verlassen den Platz nicht. Wir bleiben. Wir wollen sehen, was passiert. Die meisten Menschen sind – wie wir auch – geblieben. Dann wurde der gesamte Platz abgesperrt und die Militärs kamen in die Menge, um einzelne herauszuzerren. Immer zwei Militärs auf einen Demonstranten. Mich haben sie auch gepackt. In der Mitte des Platzes standen Busse. Zu denen wurden wir gebracht. Das waren so eine Art Gefangenenbusse. Da wurden wir reingestopft. Ich wusste natürlich nicht, was jetzt passieren würde. Dasselbe passierte auch meiner Freundin. Wir waren plötzlich getrennt. Nach einiger Zeit kamen dann – wahrscheinlich höher gestellte – Funktionäre und wollten die Papiere kontrollieren. Manche wurden dann mit „Raus! Und nie wieder hierher kommen.“ weggeschickt. Die anderen mussten bleiben. Es ließ sich kein System erkennen. Es war irgendwie pures Glück, das sowohl ich als auch meine Freundin wieder gehen durften.
NN: Wie fühlt man sich in einer solchen Situation? Wir haben ja gerade über Peking gesprochen.
KUNDE: Natürlich hatten wir Angst. Natürlich haben wir uns gefragt: Was passiert denn hier? Ich dachte: Wenn die dich jetzt und hier verhaften, dann geht eine Info an die Uni in Leipzig und dann war’s das mit dem Forschungsstudium. Zum Glück war es nicht so. Wir kamen jenseits des abgesperrten Gürtels wieder raus und waren glücklich, draußen zu sein. Da war es dann wieder: Diese Gefühl, dass sich all das nicht mehr zurückdrehen ließ.
NN: Wann warst du wieder in Leipzig?
Wir sind das Volk
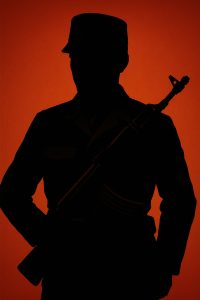
Das Bild wurde rechtefrei mit Chat GPT erzeugt.
KUNDE: Das war Ende September. Damals begannen die Montagsdemonstrationen. Die wurden zum Ventil. Anfangs waren das ja wirklich kirchliche Kreise, aber das ging dann schnell über diese Kreise hinaus. Da trafen sich ehrenwerte, friedensbewegte Menschen, aber die Grundbotschaft später war: Wir sind das Volk. Und vor allem auch: Wir bleiben hier. Und eben das war die für das System gefährlichste Botschaft. Da waren plötzlich Menschen, die nicht unter höchstem persönlichen Risiko „rübermachen“ wollten – hier waren plötzlich Menschen, den Umschwung vor Ort als Ziel ansetzten. Das war der entscheidende Moment, dass eine signifikante Menge von Menschen sagte: „Wir wollen hier die Veränderung!“ Dann kam der legendäre 7. Oktober – der 40. und letzte Jahrestag der Gründung der DDR. Damals sagte Gorbatschow zu Honecker die berühmten Worte: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Das war ein Schlüsselmoment. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, an einem Samstag. An diesem Tag war bereits klar: Wenn man jetzt in die Stadt geht, muss man mit Verhaftung rechnen. Wir haben dann bis montags – das war der 9. Oktober – gewartet. Für mich stand fest: Wenn ich jetzt nicht dabei bin, dann kann ich nicht mehr reinen Gewissens in den Spiegel schauen. An der Uni wurde natürlich eindrücklich gewarnt. „Wer zur Montagsdemo geht“, hieß es. „muss mit seiner Exmatrikulation rechnen.“ Das war aber nur ein Teil des Drohpotenzials. Da gab es aber auch noch die Warnung meines Bruders. Der ist sechs Jahre jünger als ich. Er war damals bei der Armee, wo er hin musste, und war durch Zufall in Leipzig stationiert. Am 8. Oktober habe ich ihn besucht. Und mein Bruder sagte mir dann: „Geh da bloß nicht hin. Wir haben einen Schießbefehl erhalten. Wir haben scharfe Munition bekommen.“ Von anderen hörte man, dass auch die Krankenhäuser in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden waren, um gegebenenfalls die Opfer zu versorgen. Das war also die äußere Situation vor der Montagsdemo am 9. Oktober.
NN: Du bist aber hingegangen?
Die Sechs von Leipzig
KUNDE: Ganz viele haben Mut bewiesen und sind hingegangen, um eine friedliche Demonstration durchzuführen. Die Demo fand dann auf dem Ring statt, der die gesamteInnenstadt umgibt. Startpunkt war die Nikolaikirche. Dort setzte sich dieser Tross von geschätzt 60.000 Menschen in Gang. Es ging dann über Oper und Gewandhaus Richtung Bahnhof und quasi auf der anderen Seite des Rings dann wieder zurück. Der entscheidende Punkt war das Gebäude der Staatssicherheit, die sogenannte „Runde Ecke“. Dort standen bewaffnete Soldaten. Viele von uns Demonstranten hatten Kerzen in der Hand. Wir mussten alle diesen Punkt passieren. Das war der Augenblick höchster Anspannung, denn alle wussten, dass es jederzeit hätte eskalieren können, aber zum Glück ist nichts passiert. Alle Demonstranten verhielten sich friedlich. Niemand hat provoziert. Als der Zug diesen Punkt passiert hatte, ging ein tiefes Aufatmen durch die Menge. Es war nicht geschossen worden. Erst später hat man erfahren, dass es da im Hintergrund die Gruppe der „Sechs von Leipzig“ gab. Das waren Persönlichkeiten, die sich stark dafür engagiert haben, dass nicht die „chinesische Lösung“ praktiziert werden würde.
NN: War nicht auch Kurt Masur ein Mitglied dieser Gruppe?
KUNDE: Ganz genau. Er gehörte dazu. Ich kann aber nicht genau sagen, wer noch dazu gehörte. Es waren in jedem Fall auch Parteifunktionäre dabei, denn es war wichtig, dass auch bei denen ein Umdenken stattfindet.
[Anm. d. Red.: Die Mitglieder der „Sechs von Leipzig“ warem Kurt Masur (Gewanhausdirektor), Peter Zimmermann (Theologiedozent), Bernd-Lutz Lange (Kabarettist), Kurt Meyer (Sekretär der SED-Bezirksleitung Leipzig), Jochen Pommert (Sekretär für Agitation und Propaganda der SED-Bezirksleitung Leipzig) und Roland Wötzel (Sekretär für Wissenschaft und Erziehung der SED-Bezirksleitung Leipzig.]
Tagesthemen
KUNDE: Ich will das jetzt nicht überinterpretieren, aber ich denke schon, dass auch die Soldaten, die bewaffnet vor der Runden Ecke standen, gemerkt haben, dass auch sie Teil des Volkes sind und also zu dem anderen Teil gehören. Die meisten standen ja nur dort, weil sie dienstverpflichtet waren. Vielleicht haben die auch niemals geglaubt, wirklich von der Waffe Gebrauch machen zu müssen. Das Ganze ging jedenfalls so ungefähr drei Stunden – von 18 bis 21 Uhr. Dann hat sich das wieder aufgelöst und man ging nach Hause, um – das war Kult – die „Tagesthemen“ zu schauen, Westfernsehen also, denn dort wurde berichtet. Da fand also gewissermaßen die mediale Spiegelung statt. Natürlich war damit die ganze Sache noch nicht entschieden, aber diese Demonstration am 9. Oktober war der Kipppunkt. Danach ging es ja dann relativ schnell. Honecker trat zurück; es folgte der furchtbare Herr Krenz, der sich zum Glück als erster Mann im Staat nicht lange hielt; es gab das sogenannte „Neue Forum“, wo man sich, als er noch gefährlich war, mit Namen und Adresse eintragen musste. Schließlich kam dann der Mauerfall am 9. November `89. Dieses Ereignis nahm den enormen Druck aus dem Kessel und wurde von den allermeisten als langersehnte Befreiung empfunden.
NN: Der 9. Oktober war aber nicht die letzte Montagsdemo?
KUNDE: Nein, aber es war die erste ganz große. Danach wurden es immer mehr und der innere Gestus der Demonstrationen hat sich natürlich auch gewandelt. Da gab es dann diejenigen, die sagten „Wir bleiben hier und wollen den Wandel“ bis hin zu D-Mark- und Helmut-Kohl-Schreiern.
NN: Bleibt also die Frage, warum eigentlich nicht der 9. Oktober zum Feiertag erhoben wurde. Warum der 3. Oktober?
KUNDE: Das haben wir uns auch immer wieder gefragt. Meine Vermutung ist, dass Kohl den Tag der deutschen Einheit auf jeden Fall vor den 7. Oktober legen wollte, denn der 7. Oktober war ja Tag der Staatsgründung der DDR. Warum es nun ausgerechnet der 3. Oktober geworden ist, kann ich nicht sagen. Immerhin: Mein vorhin erwähnter jüngerer Bruder hatte schon immer am 3. Oktober Geburtstag. Plötzlich wurde also ein Feiertag daraus. Am 18. März 1990 fand ja dann die erste demokratische Wahl statt und mit dem Sieg der CDU wurden Ideen von einer Tranformation der DDR zu einer schönen Utopie. Das letzte Glied in der Kette war dann im August 1990 der Staatsstreich gegen Gorbatschow. Damals ist mir dann bewusst geworden, wie eng dieses Zeitfenster war, das diese Umwälzungen ermöglichte. Ohne Gorbatschow wäre das alles niemals möglich gewesen. Und das größte Wunder ist doch, dass ein derart verknöchertes System wie die alte Sowjetunion eine solche Persönlichkeit hervorgebracht hat. So etwas passiert nicht oft in der Geschichte. Aber Leute wie Putin erlebten dasselbe als Katastrophe – als Voraussetzung eines heutigen militärischen Rückeroberungswahns.

